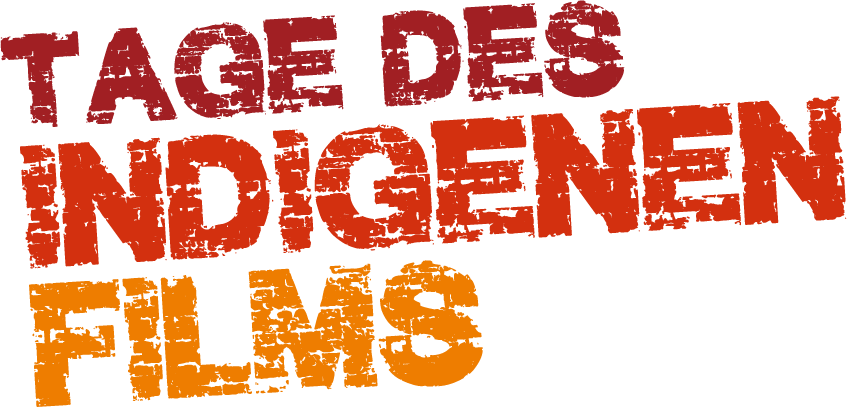

22. - 26.11.2019
Editorial
Zum 9. Mal finden die Tage des indigenen Films VOM 26. BIS ZUM 28. NOVEMBER 2019 statt. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem li.wu. – Programmkino, in dem wir die Filme auch dieses Mal zeigen werden.
Indigene Gesellschaften werden weltweit innerhalb ihrer spezifischen regionalen und politischen Kontexte marginalisiert.
Ihre Kulturen nehmen auf vielfältige Weise Bezug zur leidvollen Geschichte des Kolonialismus und zu dessen fortdauernden gegenwärtige Auswirkungen. Die Aushandlung indigener kultureller Identität ist davon geprägt, sich einerseits gegenüber der hegemonialen westlichen Kultur und Lebensart zu behaupten und andererseits diese auch selbstbestimmt anzunehmen – also autonom die eigenen Lebensumstände zu gestalten.
Weiterhin finden sich sehr konkrete kolonialistische Praktiken in der gegenwärtigen Lebensrealität Indigener wieder. Noch immer wird vielen Gruppen ihr Recht auf ein die von ihnen traditionell bewohnten Gebiete angestammtes Territorium oder darauf, einen Lebensraum selbstbestimmt zu wählen, abgesprochen. Private und nationalstaatliche Akteure begehen in Verfolgung ihrer wirtschaftlichen Interessen Raubbau an den Bodenschätzen, was auch noch im 21. Jahrhundert zu Vertreibung indigener Gesellschaften führt. In der medialen Darstellung indigener Menschen werden Stereotype und Klischees von den „wilden Völkern“ reproduziert; in Film und Fernsehen haben sie Indigene selten eine eigene Stimme. Mit den Tagen des indigenen Films wollen wir das Interesse wecken für die Kultur und soziale Situation indigener Gesellschaften und bieten Indigenen eine Plattform, ihre Lebenssicht aus der eigenen Perspektive darzustellen. Die Beschäftigung mit indigenen Kulturen kann unsere Weltsicht und unser Verhalten zu mehr gegenseitigem Verständnis beitragen, was verändern und ein konstruktives Miteinander auf Augenhöhe überhaupt erst ermöglichen.
Programm der Filmtage 2019
Alle Veranstaltungen finden im Lichtspieltheater Wundervoll li.wu. in der Friedrichstraße 23 statt. Moderierte Diskussion im Anschluss an die Vorführungen.
VORTRAG
„Indigene Gemeinden Mesoamerikas in Verteidigung von Land, Leben und Freiheit“
Der Workshop gibt Einblick in die Widerstände der indigenen Bevölkerung gegen die Interessen von Großkonzernen, die die zahlreichen natürlichen Reichtümer der Region in Waren verwandeln wollen.
Zu diesem Zweck setzen sie mit Unterstützung der Regierungen Megaprojekte durch wie Öl- und Gaspipelines, Staudämme, Bergbauprojekte sowie riesige Plantagen mit Ölpalmen, Soya, Ananas, Mais usw.
Dies führt zu einer systematischen Verletzung der Menschenrechte – zu Vertreibungen, Korruption, Kriminalisierung, Spaltung der Gemeinden, Gewalt bis hin zu Morden an Aktivist*innen.
Anhand von drei kurzen Videos werden die Widerstände von Gemeinden aus Guatemala, Honduras und Mexiko vorgestellt, die ihre Berge, Flüsse und Meere gegen Bergbau-, Wasser- und Windkraftprojekte verteidigen.
Die Videos sind im Rahmen der Karawane Mesoamerika für das Buen Vivir der Menschen im Widerstand entstanden, die sich mit 17 zumeist indigenen Gemeinden ausgetauscht hat.
Die Moderatorin des Workshops war Teil der Karawane und produzierte die Videos in Zusammenarbeit mit den Gemeinden.

Ephraim und das Lamm
Der 9-jährige Ephraim lebt zusammen mit seinem Vater in bitterer Armut auf dem Land im Norden Äthiopiens. Seine Mutter starb bei der letzten Hungersnot. Da der Regen ausbleibt und ihre Existenz bedroht ist, beschließt der Vater, Arbeit in Addis Abeba zu suchen und seinen Sohn zu Verwandten ins Hochland zu bringen. Ephraim darf sein geliebtes Lamm Chuni mitnehmen, aber bei seinem strengen Stiefvater Solomon fühlt er sich nicht wohl. Er hilft lieber den Frauen der Familie beim Kochen, anstatt das Feld mit dem Ochsen zu pflügen. Solomon fordert Ephraim auf, seine Männlichkeit zu beweisen, in dem er sein geliebtes Lamm für das anstehende Fest schlachtet. Ephraim versucht das um jeden Preis zu verhindern. Er plant die Heimreise in sein Dorf und verkauft Teigtaschen auf dem Markt, um für Bustickets für sich und sein Lamm zu sparen. Ephraims belesene Freundin Tsion unterstützt ihn. Sie interessiert sich für den Klimawandel und moderne Landwirtschaft. Auch sie will das traditionelle Leben ihrer Familie hinter sich lassen und lieber studieren.
Wenige Filme aus Äthiopien schaffen es, international wahrgenommen zu werden. EPHRAIM UND DAS LAMM zeigt das üppige Grün des äthiopischen Hochlands und die Lebensrealität seiner BewohnerInnen. Damit setzt er den bekannteren Bildern politischer und wirtschaftlicher Krisen Äthiopiens einen Einblick in die Alltagskultur und die Schönheit des Landes entgegen.
Der Film nimmt hierfür keine Erklärhaltung ein - die epische Landschaft und die ausdrucksstarken Persönlichkeiten stehen für sich. Dabei werden die Herausforderungen der Menschen nicht ausgespart. Die Heimat, die in der Tradition, in der Familie oder in der Herkunftsregion gefunden wird, ist bedroht. Die Landbevölkerung ist der globalen Klimakrise ausgeliefert. Der Film zeigt, was die Auseinandersetzung damit für einzelne Betroffene bedeutet und wie sich ein gesellschaftlicher Wandel vollzieht.
EPHRAIM UND DAS LAMM ist auch ein Märchen, in dem der Held Aufgaben in einer realen und doch fabelhaften Umgebung meistern muss. Der Held ist ein Kind, dessen Träume die Handlung ebenso bestimmen wie die harte Realität, die ihn zwingt, früh erwachsen zu werden.
Der Filmemacher Yared Zeleke musste seine äthiopische Heimat als Zehnjähriger aufgrund politischer Unruhen verlassen und wuchs weiter in den USA auf. Bevor er sich dem Film zuwandte, arbeitete er bei mehreren NGOs und beschäftigte sich mit der Verbesserung der Ernährungssituation und den Auswirkungen des Klimawandels in seinem Heimatland.

Roma
In Mexiko-Citys Stadtteil Colonia Roma wohnte zu Beginn der 1970er Jahre die obere Mittelschicht des Landes. Hier lebt die 6-köpfige Familie Antonio und mit ihnen zwei Kindermädchen und Haushälterinnen, die sich Tag und Nacht um das Haus, die vier Kinder und den Hund der Familie kümmern. Cleo, eine Mixtekin, die aus einer ärmeren Gegend stammt, hält mit ihrem unermüdlichen Einsatz die Familie emotional zusammen. Sie verliebt sich in den kampfsportbegeisterten Fermín, der in einem Slum am Stadtrand wohnt. Als sie ihn mit ihrer Schwangerschaft konfrontiert, lässt er nichts mehr von sich hören. Des Weiteren sorgt sich Cleo darum, ihre Beschäftigung zu verlieren. Doch die Frauen im Hause Antonio realisieren, dass sie trotz ihrer Klassenunterschiede zusammenhalten müssen, um die persönlichen Tragödien in politisch turbulenten Zeiten zu überstehen.
Im dokumentarisch inszenierten Film werden die Geschichten jener Menschen in den Vordergrund gerückt, die sonst meist im Hintergrund bleiben. Roma wirft gleichsam ein Schlaglicht auf das Fronleichnam-Massaker, bei dem die paramilitärische Organisation Los Halcones, ausgebildet von der CIA, protestierende Studenten ermordete. Dies war Teil des sogenannten schmutzigen Krieges, indem Tausende Oppositionelle, organisierte ArbeiterInnen und Linke entführt, gefoltert und ermordet wurden. Nebenbei werden auch die Enteignungen indigener Landbesitzer in der damaligen Zeit und ihr Widerstand erwähnt.
Roma ist ein Schwarz-Weiß-Film zu Zeiten der CGI-Technik. Die Protagonisten bewegen sich durch Mexico-Stadt, wie es vor 50 Jahren ausgesehen hat, obgleich es sich durch das Erdbeben von 1985 stark veränderte. Regisseur Alfonso Cuarón rekonstruiert im Film auch die Situation seiner eigenen Kindheit: Er war 9 Jahre alt, als er in der gleichen Straße lebte, in der auch Roma spielt. Er widmete seinen Film der ehemaligen Haushälterin, der heute über 70-jährigen Libo, der Cleo nachempfunden wurde. Die Cleo des Filmes wird von der Laiendarstellerin Yalitza Aparicio gespielt, die auf dem Dorf aufwuchs und sich vor den Dreharbeiten in der Ausbildung zur Erzieherin befand. Sie wurde mit dem Oscar für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.
VORTRAG
„Man schenkt keinen Hund.“
Die Publikation zu dem Ausstellungsprojekt „Man schenkt keinen Hund“ setzt sich in Zusammenarbeit mit Künstler*innen, Autor*innen, Kunstvermittler*innen, wie Dozent*innen und Kursteilnehmer*innen von „Integrationskursen“ mit dem herrschenden Integrationsimperativ auseinander und untersucht, wie sich dieser in den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge autorisierten Lehrwerken für „Integrationskurse“ für Zuwander*innen pädaogogisch niederschlägt. Die Publikation ist als Reader in einem offenen „diskursanalytischen“ Sinne angedacht.
In der Menge der gegenwärtig auf dem Markt erhältlichen vom BAMF autorisierten Deutschlehrwerke für „Integrationskurse“ wird Migration, werden ihre Akteur*innen in erster Linie aus der Perspektive eines nationalen Blickregimes gezeigt und erzählt. Die als repräsentativ vorgeführte „Mehrheitsgesellschaft“ setzt sich in dieser Logik als „typisch Deutsch“ zusammen – teilweise scheinbar fast unberührt von dem Einwanderungsgeschehen oder den demografischen Verschiebungen der letzten Dekaden.
Es geht uns darum, das in den Lehrwerken – ihren Texten und Bildern – eingeschriebene Verständnis einer Kultur als Ausdruck homogen gedachter nationaler Identität zu problematisieren. Das heißt, aus der konkreten Detail-Anschauung von Repräsentationen und Narrativen eine strukturelle Kritik des Konzepts „Integration“ und seinen Implikationen herauszuarbeiten – auch vor dem Hintergrund aktuell und zyklisch immer wieder geführter Debatten um „Wertegemeinschaft“ und „Leitkultur“.
Christine Lemke lebt und arbeitet als Künstlerin & Autorin in Berlin. Sie studierte Literaturwissenschaft und Bildende Kunst in Düsseldorf und an der HfbK in Hamburg und hatte ein Postgraduiertenstipendium an der Jan van Eyck Academie in Maastricht, NL
Sie veröffentlicht Essays, Katalogbeiträge und Rezensionen. Das eigene Schreiben bildet oftmals den Ausgangspunkt und Bezugsrahmen ihrer künstlerischen Praxis. Ihre Kombinationen aus angeeignetem Bildmaterial und dazu / damit entstehenden Text-Formen kommen als performative Lesungen, Editionen, Hörstücke oder Videos zur Aufführung & verfolgen dabei einen bildkritischen Ansatz, indem sie autobiographische, historische und soziokulturelle Narrative motivisch herausarbeiten und / oder poetisch wenden.
Zu ihrer künstlerischen Arbeit unterrichtet Christine Lemke Deutsch als Zweitsprache in „Integrationskursen“ in einem Migrantenverein in Neukölln.

Ixcanul – Träume am Fuß des Vulkans
Die 17-jährige Maria lebt auf einer Kaffeeplantage am Fuße des Vulkans Ixcanul im Hochland Guatemalas. Ihre Familie führt ein ländliches Leben, geprägt von der Arbeit auf der Plantage, Viehhaltung und Religion. Maria wird von ihrer Mutter auf die bevorstehende Hochzeit mit dem Vorarbeiter Ignacio vorbereitet. Die Eltern sind sich einig - eine wirtschaftlich sinnvolle Partie. Doch Maria hat kein Interesse an Ignacio. Sie fragt sich, ob ein anderes Leben möglich ist und wie wohl die Welt auf der anderen Seite des Vulkans aussieht. Der Kaffeepflücker Pepe will nach Amerika und er könnte sie mitnehmen, doch dafür setzt er sie unter Druck. Marias Sehnsucht, ihr Leben selbst zu bestimmen, trifft auf die bittere Realität.
IXCANUL ist ein bewegender Spielfilm über das bittere Schicksal Marias und wirkt doch wie ein Dokumentarfilm. Er führt die ZuschauerInnen ganz nah an den Alltag einer Maya-Familie heran und gibt ihnen viel Zeit, deren Welt auf sie wirken zu lassen.
Der Film entstand als Regisseur Jayro Bustamante in die Region zurückkehrte, in der er aufwuchs. Er veranstaltete im ländlichen Guatemala Workshops und ließ sich die Lebensgeschichten von Frauen der Kaqchikel Maya erzählen. Er interessierte sich insbesondere für Beziehungen zwischen Müttern und ihren Töchtern. Dabei traf er die echte Maria, deren Geschichte der Anstoß für IXCANUL wurde. Ferner traf er dort die beiden Schauspielerinnen, die Mutter und Tochter verkörpern. Sie leben selbst am Fuße des Vulkans und stehen zum ersten Mal vor der Kamera. Der Film wurde also selbst aus indigener Lebensrealität entwickelt, anstatt nur von ihr zu berichten.
Das Mädchen Hirut
Die 14-jährige Hirut wird auf dem Schulweg von einer Männergruppe entführt und von einem von ihnen vergewaltigt. Er will sie dadurch zur Ehe zwingen - nach dem im ländlichen Äthiopien verbreiteten Brauch der Telefa. Das Opfer gilt nach so einer Tat als entehrt und ihre Eltern stimmen der Zwangsehe meist zu. Der Vergewaltiger bleibt straffrei, wenn er das Opfer heiratet. Doch Hirut kann sich mit dem Gewehr ihres Peinigers befreien. Als ihre Flucht zu scheitern droht, kann sie sich nur wehren, indem sie auf ihn schießt und ihn tötet.
Der Ältestenrat des Dorfes kommt zusammen, um über den Fall und Hiruts Schicksal zu richten. Während die Eltern um Gnade bitten, fordert die Familie des Getöteten Blutrache.
Die junge Anwältin Meaza Ashenafi aus der Hauptstadt erfährt von Hiruts Schicksal und entschließt sich, sie zu vertreten. Sie fordert einen fairen Prozess. Doch auch das staatliche Rechtssystem Äthiopiens ist von patriarchalen Vorurteilen und Korruption geprägt. Noch nie wurde eine Frau freigesprochen, die sich auf Notwehr berief. Doch Meaza und Hirut stellen sich dem Kampf und treiben somit den gesellschaftlichen Wandel in Äthiopien voran.
Der Film schafft es, über Unrecht aufzuklären und dennoch die Perspektive derjenigen zu vermitteln, die nach den Traditionen leben. Auch die betroffene Hirut hat die Werte der Dorfgemeinschaft verinnerlicht und der gesellschaftliche Wandel stellt für sie eine Herausforderung dar.
Hiruts Fall hat es 1996 tatsächlich gegeben. Er sollte einen Wendepunkt der gesellschaftlichen Diskussion über Frauenrechte in Äthiopien werden. Die Menschenrechtsanwältin und Frauenrechtsaktivistin Meaza Ashenafi machte damals auf die rechtliche Ungleichbehandlung von Frauen aufmerksam und erreichte, dass die Telefa unter Strafe gestellt wurde. Die Praxis ging daraufhin stark zurück. Ashenafi gründete eine Vereinigung äthiopischer Anwältinnen und eine Bank, die äthiopische Frauen mit Kleinkrediten unterstützt. Heute ist sie die Präsidentin des höchsten äthiopischen Gerichts und berät die Vereinten Nationen.
Der Regisseur Zeresenay Berhane Mehari ist in Addis Abeba aufgewachsen und lernte dort Ashenafi kennen. Er lehnte mehrere Angebote von ProduzentInnen ab, die die Geschichte auf Englisch produzieren wollten. Er bestand darauf, den Film auf Amharisch, der äthiopischen Verkehrssprache, umzusetzen, um auch Betroffene zu erreichen, die nach den ländlichen Traditionen leben. An der Umsetzung waren hauptsächlich Äthiopierinnen beteiligt und zum ersten Mal wurde ein äthiopischer Film von einer Kamerafrau fotografiert. Angelina Jolie unterstützte das Projekt als Co-Produzentin und verschaffte dem Film weltweite Aufmerksamkeit.

Merata: How Mum Decolonised the Screen
Merata Mita war die erste indigene Frau, die einen Spielfilm produzierte. Für manche gilt sie als die "Großmutter des indigenen Films". Ihr Antrieb war es, die Leinwand zu dekolonisieren und daran arbeitete sie als Regisseurin, Schauspielerin, Produzentin und Dozentin. Sie inspirierte indigene FilmemacherInnen auf der ganzen Welt. Mita war zugleich politische Aktivistin, die dafür eintrat, dass die sozialen Kämpfe der Maori zugleich der Kampf für die Frauenrechte sein müssen. Sie dokumentierte diese Kämpfe und setzte sich unmittelbarer Polizeigewalt aus. Sie begleitete die Vertreibung von Maori Gruppen von ihrem Siedlungsgebiet und machte ihren Widerstand bekannt. 2010 ist Merata Mita verstorben.
Ihr ältester Sohn Hepi Mita rekonstruiert das Leben seiner Mutter aus ihrem Nachlass, dem Archiv ihrer Werke und privater Filmaufnahmen. Er zeichnet ihren Lebensweg nach und berichtet von ihrer traditionellen Kindheit, wie sie als alleinerziehende Lehrerin das Filmemachen für sich entdeckte und sich politisierte.
Ihr Schaffen war stets mit ihrer Familie, mit ihrer Rolle als Mutter verbunden. Das Filmemachen der Mutter hat wiederum Spuren im Leben ihrer Kinder hinterlassen. Von dieser Verbindung erzählt die Familie, wodurch die bedeutende Filmemacherin gefühlvoll portraitiert wird.
Die vielschichtige Dokumentation thematisiert, was es auf persönlicher Ebene bedeuten kann, Filmemacherin zu sein. Ferner erzählt sie ein Stück neuseeländischer Kolonialgeschichte aus der Sicht aktivistischer Maori. Und sie zeigt, dass die Arbeit mit Archivmaterial eine kraftvolle Persönlichkeit wieder auferstehen lassen kann.
VORTRAG
Schule als Instrument der Unterdrückung:
Der Vortrag untersucht Ursprünge und Geschichte des Indian Residential School Systems in Kanada und zeigt, wie Beschulung als Machtinstrument der Mehrheitsgesellschaft genutzt wurde, um junge Indigene ihren Familien und Traditionen zu entfremden und sie als assimilierte Hilfsarbeiter zu „nützlichen“ Mitgliedern der kanadischen Gesellschaft zu machen. Es werden die oft menschenunwürdigen Bedingungen aufgezeigt, die in diesen Schulen herrschten, und die Bedeutung diskutiert, die dieses Schulsystems auch nach seiner Schließung bis heute für indigene Gemeinschaften in Kanada und ihre Beziehung zur kanadischen Mehrheitsgesellschaft hat. Eingebettet wird die Fallstudie in einen internationalen Vergleich, u.a. durch die Erörterung von Sequenzen des Dokumentarfilms Schooling the World.

Indian Horse
Saul Indian Horse ist sechs, als er beschließt, dass er niemals zur Schule gehen will, denn seinen Bruder hat sie krank gemacht. Doch nachdem er seine Familie verliert, wird auch er gezwungen eine kanadische Residential School zu besuchen. Die Kinder werden der Willkür der katholischen Priester unterworfen, die die Schule führen - und von ihnen missbraucht. Auf dem Eishockeyfeld kann Saul der Tristesse entfliehen. Er wird schließlich von einer Pflegefamilie aufgenommen und findet in einem indigenen Hockey-Team wahre Freunde. Sogar die NHL-Mannschaft aus Toronto holt ihn ins Team. Für Fans, Gegner und sogar seine Mitspieler bleibt er aber der kuriose "Indianer" auf dem Hockeyfeld. Seine sportlichen Erfolge werden stets von rassistischen Anfeindungen begleitet und schließlich verweigert er sich der Sportlerkarriere. Seine Vergangenheit holt ihn ein und er begibt sich auf den Weg, sie aufzuarbeiten.
In Kanada existierten über 1300 Residential Schools - Internate, die ausschließlich von kanadischen Indigenen besucht wurden. Die SchülerInnen sollten dem kulturellen Einfluss ihrer Eltern entzogen und im Sinne der kanadischen Kultur vermeintlich "zivilisiert" werden. Dabei wurde ihnen verboten, in ihrer Muttersprache zu sprechen. Die Schulen wurden meist von Kirchenvertretern geführt.
Die letzten Residential Schools in Kanada wurden erst in den 1990er Jahren geschlossen. Erst danach begann Kanada, sich mit der strukturellen Ausübung von Gewalt und dem sexuellen Missbrauch an den SchülerInnen zu befassen. Bis heute gilt das historische Trauma für viele Überlebende als nicht ausreichend aufgearbeitet. INDIAN HORSE ist der erste große Kinofilm, der sich diesem Thema widmet.
Der junge Saul wird vom 11-jährigen Eishockeyspieler Sladen Peltier gespielt. Trainiert wird er von seinem Vater, der die Diskriminierung als indigener Spieler aus seiner eigenen Geschichte kennt. Auch die beteiligte Schauspielerin Edna Manitowabi wurde zum Besuch einer Residential School gezwungen.
Der Film basiert auf der Buchvorlage von Richard Wagamese, dessen Eltern, angehörige der Ojibwe, von ihren Verwandten getrennt wurden und eine Residential School besuchen mussten. Wagameses Buch orientiert sich unter anderem an der Lebensgeschichte des ersten indigenen NHL-Spielers Fred Sasakamoose.
Der kanadische Regisseur Stephen Campanelli produzierte INDIAN HORSE gemeinsam mit Clint Eastwood.

Min Dît – Die Kinder von Diyarbakir
Die 10-jährige Gülistan, ihr jüngerer Bruder Firat und ihre wenige Monate alte Schwester erleben in einer kurdischen Mittelstandsfamilie im Südosten Anatoliens zunächst eine behütete, glückliche Kindheit. Die Mutter der Kinder kommt abends spät und erschöpft nach Hause und hat ihnen deshalb ein Märchen auf Tonband aufgenommen. Auf einer Autofahrt gerät die Familie bei einer vermeintlichen Verkehrskontrolle in einen Hinterhalt und beide Elternteile werden vor den Augen der Kinder von Todesschwadronen des informellen türkischen Geheimdienst JITEM ermordet. Von ihren Eltern bleibt den Geschwistern nur die Stimme der Mutter auf Tonband. Die Kinder kommen bei ihrer politisch aktiven Tante Yekbun in der Metropole Diyarbakir unter. Yekbun begibt sich nach Istanbul, um eine Ausreise nach Schweden vorzubereiten. Doch auch sie verschwindet plötzlich spurlos und die Kinder sind auf sich allein gestellt. Um Nahrung und Medizin zu finanzieren, verkaufen sie den Hausrat. Doch bald stirbt die kleine Schwester und die Kinder werden obdachlos, da sie die Miete nicht zahlen können. Unter den vielen anderen kurdischen Kindern, die ihr Schicksal teilen, finden sie Verbündete, die sie in den Überlebenskampf der Straße einführen. Firat lernt die Tricks der Straßenhändler und Gülistan begleitet die Sexarbeiterin Dilan, in der sie eine Vertraute findet. Die beiden Geschwister stoßen schließlich auf den Mörder ihrer Eltern und begegnen ihm mit einer List, die den Kreis von Gewalt und Vergeltung durchbricht.
MIN DÎT wirft die ZuschauerInnen mitten in den Alltag des Bürgerkriegs in Türkisch-Kurdistan, gezeigt aus der Sicht zweier kurdischer Kinder. Der Film nutzt die Millionenstadt Diyarbakir, um nebenbei Schlaglichter auf die sozialen Spannungen und die politische Geschichte der Türkei zu werfen. Diyarbakir hatte einen Bruchteil an EinwohnerInnen, bevor ab den 1990ern Hunderttausende KurdInnen aus ihren zerstörten Dörfern in die Stadt flohen. In dieser Zeit, in der auch die kurdische PKK viele Anschläge verübte, entführte und ermordete der informelle türkische Geheimdienst bis zu 18.000 vornehmlich kurdische Oppositionelle. Die zerstörte armenische Kirche, in der die Straßenkinder Schutz suchen, erinnert an die Verbrechen, die ein Jahrhundert zuvor an diesem Ort verübt wurden. Doch der Film stellt nicht die Frage der Schuld in den Vordergrund sondern entwickelt ambivalente Bilder von den Beteiligten der Gewalt.
Der Berliner Filmemacher Miraz Bezar zog nach Diyarbakir, um vor Ort die realen Geschichten zu recherchieren, aus denen er seinen ersten fiktionalen Langfilm erarbeitete. Vor Ort traf er auch die Laiendarstellerin Senay Orak, die während der Dreharbeiten zehn Jahre alt war und für ihre Rolle als Gülistan ausgezeichnet wurde. Bezar fand in Deutschland keine Filmförderung und finanzierte die Produktion selbst, bis ihm das Geld ausging und ihm schließlich Fatih Akin als Co-Produzent zur Seite stand.
Bezar musste auch selbst den Vertrieb in die Türkei übernehmen, nachdem sich kein türkischer Verleih bereit erklärte, den Film in die Kinos zu bringen. Schließlich lief er als erster kurdischsprachiger Film mit türkischen Untertiteln in der Türkei und feierte auf Filmfestivals in Antalya und Istanbul Erfolge.

Sameblod / Das Mädchen aus dem Norden
Die weißhaarige alte Dame Christina fährt zur Beerdigung ihrer Schwester in den Norden Schwedens. Mit den hier lebenden Samen will sie nichts zu tun haben. Doch hier im Norden erinnert sie sich, wie sie einst zu dem wurde, was sie heute ist.
60 Jahre zuvor ist die Tochter samischer Rentierzüchter, genannt Elle Marja, 14 Jahre alt. Im Schweden der 1930er Jahre werden die Kinder der Samen von ihren Eltern getrennt, und so wird auch Elle Marja auf ein strenges schwedisches Internat geschickt. Hier soll sie sich der schwedischen Kultur anpassen. Sie darf ihre Muttersprache nicht sprechen. Ausgrenzung und Diskriminierung gehören zum Alltag der samischen Schüler. Sie müssen erniedrigende Untersuchungen über sich ergehen lassen, die ihre vermeintliche Minderwertigkeit beweisen sollen. Doch Elle Marja hat einen starken Willen. Sie will noch besser in der Schule, noch schwedischer als die Schweden werden. Der Zugang zu höherer Bildung soll ihr trotzdem verwehrt bleiben. Und so muss sie ein großes Opfer erbringen, um der Unterdrückung zu entkommen.
DAS MÄDCHEN AUS DEM NORDEN erinnert daran, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts pseudowissenschaftliche Lehren angeblich höher- und minderwertige “Rassen” verbreitet waren, die Diskriminierung von Minderheiten auch in Europa zu Staatsdoktrin machten.
Der Film zeigt dabei auch die Widersprüchlichkeit der damaligen Minderheitenpolitik auf: Einerseits wurden Samen zur Anpassung gezwungen und ihre Kultur unterdrückt, andererseits wurde ihnen die Möglichkeit in der schwedischen Gesellschaft aufzugehen verwehrt und die samische Kultur nur als schmückende Folklore zugelassen.
DAS MÄDCHEN AUS DEM NORDEN ist das Spielfilm-Debüt der jungen schwedisch-samischen Regisseurin Amanda Kernell, die mit dem Werk auch ihre eigene Familiengeschichte ergründet. Sie erforscht mit in ihrem Debüt die heute noch existente Abwehr vieler Samen, sich mit ihrer ethnischen Identität auseinanderzusetzen. Dabei verzichtet sie auf verklärende Folklore und gibt den Samen selbst eine Stimme. Alle Samen im Film wurden von samischen SchauspielerInnen verkörpert. Kernell gewann mit dem Film den Preis für das beste Regiedebüt auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2016.